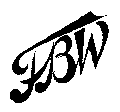FBW - Der Gyrobus - Voller Schwung unterwegs
Bereits in der Frühzeit des Rades vor rund 5000 Jahren kannte der Mensch Handspindeln und Töpferscheiben mit Schwungrad. Mitte des 19. Jh. kamen die ersten Kreiselkompasse auf. Der erste erfolgsversprechende Elektrogyro wurde 1944 von der Maschinenfabrik Oerlikon patentiert. Das neue, umweltfreundliche Antriebsprinzip mit dem Buschassis aus Wetzikon fand weltweit grosse Beachtung. Nicht nur fuhr der Gyrobus in Yverdon-les-Bains, sondern auch im belgischen Gent sowie in damaligen Léopoldville im damaligen Belgisch-Kongo. Am 17. Januar 1956 verlies Chassis Nr. 3900 die Werkhallen von FBW. Es sollte der letzte gebaute Gyrobus sein.
Dieser Artikel erschien erstmals im Magazin Last & Kraft 3/2004

Der Begriff «Gyro» stammt aus dem Griechischen und bedeutet Kreis, Umdrehung und im erweiterten Sinn auch Kreisel und Schwungrad. Die für unsere Kultur erfolgreiche «Erfindung» des Rades hat vor gut sechstausend Jahren stattgefunden. Die Hochkulturen in Mesopotamien besassen nebst der Technik der Metallverarbeitung auch erste Kenntnisse über das Rad. Gegen Ende der Obed – Zeit (um 3500 v. Chr.) finden wir in der Region Töpferscheiben mit gelagerten Achsen. Die Hochkulturen des Orients beinflussten die Völkestämme in Europa durch die Handelsbeziehungen nachhaltig. Auf verschiedenen Wegen und in mehreren Zeitschritten gelangten die kulturellen Errungenschaften nach Westen. Schwungscheiben und –räder werden vor allem dazu gebraucht, ungleichförmige Drehbewegungen, wie sie etwa bei Kurbeltrieben auftreten, zu harmonisieren. Beispiele sind die alten einzylindrigen Dampf- und Diesel-Strassenwalzen. Das Prinzip der oft nur kurzzeitigen Energiespeicherung hat im Laufe der Zeit eine grosse Anzahl Erfinder ermuntert, Schwungräder als Energiespeicher vorzusehen. 1852 wies der französische Physiker Léon Foucault nach, dass ein horzontalachsiger Kreisel unter Einfluss der Erdrotation stets danach trachtet, seine Rotationsachse in Nord-Süd-Richtung einzustellen. Der heute milionenfach in Luft- und Seefahrt eingesetzte Kreiselkompass wurde erfunden. Rund 30 Jahre später, d.h. 1884, konstruierte der Amerikaner John A. Howell ein Torpedo, bei dem ein 50 Kilogramm schweres Schwungrad gleichzeitig als Antriebsquelle und als Richtungsstabilisator diente. Vor dem Abschuss wurde das Schwungrad auf dem Trägerschiff mittels Dampfturbine auf 10’000 Umdrehungen pro Minute beschleunigt. Der Engländer Frederick Lanchester baute 1896 das erste britische Auto. Nachdem er 1901 Scheibenbremsen für Strassenfahrzeuge vorschlug, patentierte er 1905 (Brit. Patent Nr. 7949) die Kombination eines Verbrennungsmotors mit einem Schwungradspeicher. Er hoffte, auf diese Weise auf ein Schaltgetriebe verzichten zu können. In seiner Patentschrift beschreibt er auch einen Omnibus mit Schwungradantrieb, der an den Haltestellen mechanisch aufgeladen werden sollte. Seine Konstruktion wäre jedoch kaum realisierbar gewesen, hat er doch die Kreiselkräfte des (horizontal drehenden) Energiespeichers und die Luftreibung der offenen Konstruktion unterschätzt. Die erste erfolgsversprechende Konstruktion eines «Elektrogyro» geht auf die Schweizer Patente Nr. 242086 und 244759 zurück. Das Gesuch wurde von der damaligen Maschinenfabrik Oerlikon MFO (später Teil von BBC, dann ABB) dem eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum am 19. Juli 1944 eingereicht und am 15. April 1946 als Patent eingetragen. Als Erfinder wurde der damalige Oberingenieur Bjarne Storsand genannt. Storsand wurde 1899 als Sohn des Maschineningenieurs und Direktor der Norwegischen Staatsbahn in Oslo geboren. Nach dem Studium der Elektotechnik an der Technischen Hochschule in Trondheim fand er in Norwegen keine Stelle, worauf er sein Glück in der Schweiz versuchte. Nach kurzer Zeit in der Verkaufsabteilung für Bahnen bei der MFO wurde er Konstruktionschef in der Abteilung für Gleichrichter und Elektrolyseure, Anlagen zur Gewinnung von Wasserstoff und Sauerstoff aus Wasser. Im Zeitalter der Rohstoff- und Energieknappheit während des Zweiten Weltkriegs begann Storsand nach neuen Lösungen zum Antrieb von Fahrzeugen zu suchen. Dies führte ihn zur Idee des «Elektrogyro». Während eines Vortrags fasste Ingenieur Storsand die Vorteile der Gyrofahrzeuge wie folgt zusammen:
- 1. Geringe Unterhaltskosten dank Ausrüstung mit robusten und zuverlässigen Elektomotoren.
- 2. Geringe Anlagekosten dank Wegfall der Oberleitung.
- 3. Freiheit der Streckenführung zwischen den Ladestationen.
- 4. Elektrische Energie ist in den meisten Ländern ein nationales Gut.
- 5. Gyrofahrzeuge sind frei von Abgasen und Lärm.

Tiefblick auf das Fahrgestell während der Montage des Versuchs-Gyrobus mit FBW Chassis Nr. 812 bei der MFO in Oerlikon. Bild: Chronikstube Wetzikon.
Das Herz des Gyrobus ist das Kreiselaggregat, das in Wagenmitte unter und zwischen den Längsträgern des Chassis aufgehängt ist. Den Hauptteil dieser Maschinengruppe stellt die rund 1.5 Tonnen schwere Kreiselscheibe dar, welche aus einem geschmiedeten und vergüteten Chromnickel-Molybdän-Stahl hergestellt wurde. Die Gruppe ist in einem luftdichten Gehäuse eingeschlossen, das mit einem Unterdruck von rund 0.3 bar mit Wasserstoff gefüllt ist. Dadurch konnte der innere Reibungswiderstand wesentlich reduziert werden. Einmal in Schwung, dauerte es ganze 12 Stunden, bis der (unbelastete) Gyro zum Stillstand kam. Umsichtig angeordnete Schmiervorrichtungen für die beiden Kugellager – welche von SKF entwickelt wurden – sowie ein Ölkühler auf dem Fahrzeugdach vervollständigen den mechanischen Teil des Gyro-Aggregats. Über dem eigentlichen Gyro befindet sich der elektrische Drehstrom-Motor, welcher während der Ladung den Gyro auf maximal 3000 Umdrehungen beschleunigte. Bei einem Standard-Gyro, so wie er Mitte der 50er Jahre von MFO gebaut wurde, konnten gut 5 kWh Energie nutzbar gespeichert werden. Ist die Ladung nach rund zwei Minuten beendigt, d.h. der Gyro auf 3000 Umdrehungen beschleunigt, so wurde entweder der Stecker abgezogen oder an fest installierten 500-Volt-Ladestationen die Pantographen auf dem Fahrzeugdach eingezogen. Die Drehstrommaschine des Aggregates wirkte nun als Generator, welcher elektrische Energie dem im Fahrzeugheck angeordneten mehrstufigen Fahrmotor zuleitete. Die technisch mögliche Fahrdistanz bei besetztem Bus war rund sechs Kilometer, in der Praxis wurden jedoch alle vier Kilometer eine Ladestation eingerichtet. Die MFO-Ingenieure legten den Gyrobus normalerweise so aus, dass in der Ebene mit maximal 50 Stundenkilometer gefahren werden konnte.

Place Pestalozzi: Am 30. September 1953 wurde der Gyrobusbetrieb von Yverdon offiziell eröffnet. Bild: Stadtarchiv Yverdon-les-Bains.

Hoher Gast aus Bern: Selbst Bundesrat Max Petitpierre wollte die technischen Pionierleistung sehen. Bild: Stadtarchiv Yverdon-les-Bains.

Das Chassis der Serienfahrzeuge unterschied sich wesentlich vom Prototypen. Im Bild Chassis Nr. 3495 (Yverdon-les-Bains). Bild: Chronikstube Wetzikon.
1948 gab die MFO-Geschäftsleitung grünes Licht für die Entwicklung eines pneubereiften Gyrobus und schon 1950 konnte der neun Tonnen schwere Wagen an der Mustermesse in Basel einem begeisterten Publikum vorgestellt werden. „Der Gyrobus läuft wie ein Trolleybus auf Gummireifen, benötigt aber keine Oberleitung und auch keine Batterie. Die Räder werden von einem Drehstrom-Kurzschlussankermotor angetrieben, der die elektrische Energie einem mitgeführten, horizontal umlaufenden Schwungrand entnimmt.“ Nach erfolgreichen Versuchen in Altdorf, Aarau und im sankt-gallischen Rheintal bestellte die neugegründete «Société anonyme des Transport Publics Yverdon – Grandson» TPYG bei der Maschinenfabrik Oerlikon MFO zwei 70-plätzige Busse. „Diese verkehrten auf der rund acht Kilometer langen Strecke «Tuileries de Grandson – Condémines»“, errinnert sich der heute 76-jährige, ehemalige Werkstattchef Albert Vesin. „Am Place Bel-Air im Stadtzentrum wurden die Wagen zwischengeladen.“ Stolz ist Vesin auch auf seinen offiziellen Führerausweis mit dem Eintrag «Gyrobus». „Alle fünf 1953 eingestellten Chauffeure haben die Prüfung in Yverdon absolviert, die Experten kamen dazu aus Lausanne angereist.“ Während Mitte der 50er Jahre MFO weitere 15 Gyrobusse nach Léopoldville (Belgisch-Kongo) und Gent (Belgien) lieferte, häuften sich bei den TPYG die technischen Probleme des Kreiselsystems. Auch war die Chassiskonstruktion nicht genügend stark ausgelegt. „Regelmässig mussten wir die beiden Busse mit einem Lastwagen nach Oerlikon schleppen. Das war im unbeheizten Wagen im Winter kein grosses Vergnügen“, bemerkt Vesin. „Dazu kam, dass wir wegen den Ausfällen oft dieselbetriebene Postautos zumieten mussten. Die nette Geste seitens der MFO, uns auch den Prototyp als Reservefahrzeug zu überlassen, nützte unserem kleinen Betrieb wenig.“ Bereits im Jahre 1960, nach einer Fahrleistung von insgesamt rund 720’000 Kilometern, wurden die beiden Gyrobusse durch drei neue Dieselfahrzeuge Saurer-OM mit Frontantrieb ersetzt. Diese bei der «Carrosserie du Relay» in Yverdon aufgebauten Midi-Busse waren bereits damals eine Niederflurkonstruktion! „Geblieben aus der Zeit des Gyrobus ist die Errinnerung, als zur Mittagszeit die beiden überfüllten Busse die Paillard-Arbeiter nach Hause brachten“, ergänzt Vesin mit einem tränenden Auge während unseres Gesprächs im Stadtarchiv am Place Pestalozzi. Die Firma Paillard mit ihren weltbekannten Hermes-Schreibmaschinen und den legendären Bolex-Filmkameras, mit denen in den 50er Jahre u.a. am Himalya gedreht wurde, prägte während vielen Jahren das wirtschaftliche Geschehen in der Stadt am Neuenburgersee. Leider gehört auch dieses Stück Schweizer Industriegeschichte der Vergangenheit an.

Der Prototyp unterwegs im April 1951 zwischen Diepoldsau (CH) und Hohenems (A). Bild: Archiv RTB.
Im St.-Galler Rheintal verkehrte am 24. September 1940 der erste Trolleybus, welcher zwischen Altstätten und Berneck die 1897 eröffnete Strassenbahn ersetzte. Neun Jahre später, d.h. 1949 spielten die Verantwortlichen mit dem Gedanken, auch die Strassenbahn-Linie Heerbrugg-Diepoldsau durch einen nach Hohenems in Österreich verlängerten Busbetrieb zu ersetzen. Eine solche, grenzüberschreitende Busverbindung existierte bereits vor dem 2. Weltkrieg, und zwar bis 1938, als Österreich an Hitlerdeutschland angeschlossen wurde. Sechs Jahre nach Kriegsende, d.h. am 30. März 1951 fuhr der Bus wieder über die Grenze. Die Vorarlberger Nachrichten schrieben am Tag nach der Eröffnung: „Am Freitag wurde auf der ersten fahrplanmässigen Gyrobus-Linie der Welt zwischen Heerbrugg und Hohenems der Betrieb aufgenommen. Schon am Vortage fand eine Probefahrt zwischen den auf beiden Seiten der Staatsgrenze gelegenen Marktgemeinden statt, die voneinander 10 Kilometer entfernt sind. Der erste Wagen verlies an Werktagen Heerbrugg um 13:59 Uhr und traf nach 51 Minuten Fahrzeit um 14:50 in Hohenems ein.“ Ein Blick auf den damaligen Fahrplan zeigt, dass in Diepoldsau während sechs Minuten (zur Aufladung des Gyro) und an der Landesgrenze während zehn Minuten (Passkontrolle) gehalten wurde. Weiter schreibt das Blatt: „Vorarlberg macht damit den interessanten Versuch, ein dringliches Verkehrsproblem auf originelle, im übrigen Österreich noch unbekannte Weise zu lösen.“ Während dem Versuchsbetrieb im Jahre 1951 wurden auf der Strecke Heerbrugg-Diepoldsau die Strassenbahn-Kurse teilweise durch den Gyrobus ersetzt. Ein Entscheid über die zukünftige Traktionsart wurde erst definitiv 1955 gefällt. Nach dem die Strassenbahn eingestellt wurde, verkehrten ab Sommer 1956 Autobusse auf der internationalen Linie Heerbrugg-Diepoldsau-Hohenems. Dazu wurden drei Saurer 5 HP CT2D Heckmotor-Busse, welche auch zweiachsige Personenanhänger ziehen konnten, beschafft.

Ankunft: Der fabrikneue G1 in Brüssel-Anderlecht am 26. Mai 1956. Bild. Collection E. Keutgens.

Endstation: Der G2 in Merelbeke. Bild: Collection E. Keutgens.

Feierabend: Alle drei Gyrobusse im Depot in Merelbeke. Bild: Collection E. Keutgens.
Die Vorarbeiten für den Gyrobus-Betrieb in Belgien gehen zurück ins Jahr 1955, als die «Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux» am 11. Februar bei der schweizerischen MFO drei Gyrobusse bestellten. Bei FBW in Wetzikon ging die Bestellung zur Lieferung von drei Gyrobus-Chassis am 9. Mai 1955 im Büro von Verkaufschef Lindenmeyer ein. Damals war die Geschäftsleitung bei «Herr Franz», dem Sohn des Firmengründers Franz Brozincevic, die Betriebsleitung lag bei Herrn Tschupp und im Technischen Büro zeichnete Herr Manigley verantwortlich. Die drei Chassis mit den Nummern 3898, 3899 und 3900 wurden am 5.Dezember 1955, 6. Januar 1956 und 17. Januar 1956 mit zu je 31’000.- Franken fakturiert und an MFO geliefert. Rund fünf Monate dauerte die Fertigstellung bis am 26. Mai 1956 das erste Fahrzeug per Bahn in Brüssel ankam. Bereits am 10. September waren alle drei Busse mit den Bezeichnungen G1, G2 und G3 im Einsatz auf der 9.6 Kilometer langen Strecke zwischen Gent und Merelbeke. Die mit total 70 Plätzen (davon 35 Sitze) ausgestatteten, 11.7 Tonnen schweren, 10.7 Meter langen, 2.4 Meter breiten und 3.2 Meter hohen Busse ersetzten eine 1955 eingestellte Vororts-Strassenbahnlinie. Die Energie wurde aus dem 12’000-Volt-Wechselstromnetz auf 500-Volt transformiert und über sechs entlang der Fahrstrecke eingebaute, 4.8 Meter hohe Pylone an die Fahrzeug-Pantographen übertragen. Bereits am 24. November 1959 wurde der Gyrobus-Betrieb durch Dieselbusse ersetzt. Am 26. Januar 1970 musterte die Betreibergesellschaft die Gyrobusse definitiv aus. Heute existiert vom Wagenpark einzig der G3, welcher sich heute im «Vlaams Tram- en Autobusmuseum» in Antwerpen-Berchem befindet. Letztmals wurde der Gyrobus G3 mit der FBW-Chassis Nr. 3900 im Sommer 1985 für Publikumsfahrten eingesetzt: Während eines Monates fuhr der Wagen in Oostende auf einem Parcour von 1.5 Kilometer anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der städtischen Verkehrsbetriebe.
Zu Besuch in der Heimat des Gyrobus G3
Seit 2001 gibt es in Berchem, einem Vorort der Stadt Antwerpen, ein Museum, wo der Nutzfahrzeug-Interessierte nebst Autobussen und Strassenbahnen auch den einzigen erhaltenen Gyrobus G3 mit der FBW Chassis Nr. 3900 bestaunen kann.
Vlaams Tram- en Autobusmuseum
Diksmuidelaan 42
2600 Antwerpen-Berchem
Telefon 0032 3 322 44 62

Vier fabrikneue Gyrobusse am Bahnhof von Léopoldville.
Bild: Chronikstube Wetzikon.

Einheimische und Personal an einer Endstation in Léopoldville.
Bild: Chronikstube Wetzikon.
Wenig ist über den Einsatz der 12 Gyrobusse in Léopoldville bekannt. Das mag wohl daher rühren, dass der zentralafrikanische Staat, welcher 1908 als belgische Kronkolonie entstand, in den 50er Jahren inmitten seiner Ablösung vom Mutterland war und dass die niedergelassen Europäer das Land wegen den «Kongowirren» mehr oder weniger fluchtartig verlassen mussten. Am 30.Juni 1960 wurde der 2.3 Mio. Quadratkilometer grosse Staat mit seinen damals 12.8 Millionen Einwohnern unabhängig. Die Feierlichkeiten in Anwesenheit von König Baudouin warfen aber die Schatten voraus, die bis zum Jahre 1965 andauerten und als die blutigen «Kongowirren» in die Geschichte eingingen. Die einzigen uns bekannten Informationsquellen über den Gyrobus-Betrieb in Zentralafrika finden wir in Belgien und in der Schweiz. Albert van Steensel, Ingenieur bei der Société Belge Oerlikon schrieb 1955: „Während in Belgien der MFO-Gyrobus 75 Fahrgäste fasste, hatten die Fahrzeuge in Léopoldville total 90, davon 27 Sitzplätze.“ In seinen Ausführungen während einer Konferenz der «Société Royale Belge des Ingénieurs et des Industriels» gehen van Steensel und der damalige Chefkonstrukteur der MFO, Dipl. El.-Ing. ETH Ernst Dunner, auf die Technik der 12 Fahrzeuge ein: „Unsere Busse in Léopoldville erreichten eine Maximalgeschwindigkeit von 60 km/h und hatten auf dem relativ ebenen Terrain einen mittleren Energieverbrauch von 1.6 kWh pro Fahrkilometer.“ Um die Ladezeit auf 1 Minute 40 Sekunden zu reduzieren, wurde der Gyro in Léopoldville nur bis 2900 Umdrehungen geladen. Diese Zeit war notwendig, um den Kreisel mit dem 250kW-Motor von 2100 auf diese Maximal-Drehzahl zu beschleunigen. Eine interessante, nur wenigen Nutzfahrzeug-Kennern bekannte Verbindung zwischen Yverdon-les-Bains und Léopoldville bestand in der Person von Alfred Girardet. Er, welcher als Inbetriebsetzungsingenieur bei BBC in Baden (heute ABB) arbeitete, kam 1944 nach Yverdon-les-Bains, um die 1943 beschlossene Elektrifizierung der Bahn nach Sainte-Croix zu leiten. Im Rahmen seiner Tätigkeit konstruierte er auch eine 4-achsige «Krokodil»-Lokomotive, welche 1950 auf der Bergstrecke in Betrieb kam. „Wegen Rohstoffmangel wurde das Chassis aus vorhandenen Eisenbahnschienen hergestellt“, mag sich Albert Vesin erinnern. Schon damals war die Yverdon-Ste-Croix-Bahn personell eng mit dem Gyrobus-Betrieb TPYG verbunden. Der damalige Bahndirektor Gavin, welcher auch Girardet von Baden nach Yverdon-les-Bains holte, war geistiger Vater und Mitinitiant des Gyrobus-Betriebs. Er organisierte erste Testfahrten mit dem MFO-Versuchs-Gyrobus im Jahre 1950. Genau ein Monat nach dem die beiden Neufahrzeuge Ende September 1953 in den Liniendienst genommen wurden, wanderte Depotchef Alfred Girardet am 31. Oktober nach Afrika aus: Er wurde Betriebsleiter der neu gegründeten «Société d’exploitation des Gyrobus de Léopoldville». Die 12 Fahrzeuge verliessen zwischen dem 26. Januar und dem 23. September 1954 die Schweiz und wurden am 6. August 1955 in Fahrplandienst auf den insgesamt vier Gyrobus-Linien gestellt. Während den «Kongowirren» musste Girardet und seine Frau das Land verlassen. Ihren Lebensabend verbrachte das kinderlose Ehepaar im ihnen vertrauten Yverdon-les-Bains. An den Gyrobus-Betrieb in Léopoldville mag sich auch der in Antwerpen geborene Pierre Nagels erinnern, der seine Jugendjahre in Belgisch-Kongo erlebte. „So wie ich mich erinnere, verkehrten die Busse im 15-Minuten-Takt.“ Doch als der damals 26-Jährige im Jahre 1960 nach seiner Technikums-Ausbildung in Belgien wieder in den Kongo zurückkam, waren die blau-weissen Gyrobusse aus der Schweiz verschwunden. „Wegen technischen Problemen wurden die Busse während meines Aufenthalts in Europa ausser Betrieb genommen.“ Über das Schicksal der Fahrzeuge ist dem seit vielen Jahren im Schweizer Jura lebenden pensionierten Garagisten und Oldtimer-Spezialisten nichts bekannt.

Der Gyrobus G3 aus Belgien war die Hauptattraktion des Festes. Bild: EngineeringCommunication.

Schlicht: Führerstand mit Originalmütze der TPYG aus dem Jahre 1953. Bild: EngineeringCommunication.

Der vertikal eingebaute Elektrogyro zwischen zwei Sitzreihen. Bild: EngineeringCommunication.
Am Freitag 3. Oktober 2003 war es soweit: Der einzige noch existierende Gyrobus ist von Antwerpen her kommend mit einem Sondertransporter in Yverdon-les-Bains rechtzeitig zu den Jubliäumsfeierlichkeiten eingetroffen. Gefahren wurde die Strecke Antwerpen-Brüssel-Yverdon-les-Bains im 2-Schicht-Betrieb mit Fahrzeug- und Fahrerwechsel in Frankreich. Nach ersten Fotoaufnahmen in der Gegend von Pomy – an der Stelle, wo in den 50er Jahren Testfahrten mit internationalem Fachpublikum durchgeführt wurden – wurde der Gyrobus im Busdepot über Nacht garagiert und für den grossen Auftritt am Jubiläumstag bereitgestellt und geschmückt.
Am darauf folgenden Samstag feierte die Stadt das 50-Jahr-Jubiläum des öffentlichen Nahverkehrs, welcher 1953 mit zwei Gyrobussen begonnen hat. Der Gyrobus G3 aus Belgien war die Hauptattraktion des Festes. Tausende von Besuchern bestaunten den roten Bus, der auch innen zugänglich war. Mit von der Partie war auch der pensionierte Gyrobus-Chauffeur Albert Vesin. „Weil das Fahrzeug aus Belgien genau die gleiche Wagenfarbe hat wie unsere beiden Gyrobusse, erkannten die älteren Yverdoner ihren «Gyro» sogleich wieder. Noch heute sagt man nämlich in der Umgangssprache „On prend le gyro“ wenn man den Stadtbus besteigt. Dies, obwohl seit 1960 ausschliesslich Dieselbusse in der Stadt verkehren. In der Ausstellung im Schloss, wo alte Fahrpläne, Fotographien und Uniformen hinter historischen Mauern zu sehen waren, konnte auch in Erfahrung gebraucht werden, dass nebst der Firma MFO (Projektleitung, Antrieb) auch FBW aus Wetzikon (Chassis, Achsen), die Carrosseriewerke Aarburg (Aluminium-Aufbau) und Georg Fischer (Trilex-Räder) aus Schaffhausen an der Gyrobus-Konstruktion beteiligt waren.

+GF+ Trilex-Räder: Stehengeblieben bei Kilometer 70658. Bild: EngineeringCommunication.
1884 | Der Amerikaner John A. Howell baut ein Torpedo, bei dem ein Schwungrad als Antriebsquelle und als Richtungsstabilisator (Kompass) diente. |
1905 | Der Engländer Frederick Lanchester patentiert die Verbindung eines Verbrennungsmotors mit einem Schwungrad-Speicher. In seiner Patentschrift beschreibt er auch einen Omnibus mit Schwungradantrieb, der an den Haltestellen mechanisch aufgeladen werden sollte. |
1921 | Die Deutschen Stein und Matterdorf patentieren ein elektrisches Gyroschiff. |
1944 | Schweizer Patente zu Elektrogyro-Fahrzeugen der Maschinenfabrik Oerlikon MFO. |
1946 | English Electric baut eine Elektrolok mit Schwungrad als Energiespeicher bei Stromunterbrüchen. |
1946 | MFO präsentiert den ersten normalspurigen Schienentraktor mit Gyro-Antrieb. |
1948 | Entscheid der MFO zum Bau eines Versuchs-Gyrobus. |
1950 | Am 12. Juli erhält der erste Gyrobus der Welt in Zürich die erste Verkehrszulassung. Erste Publikumsfahrten wurden in Altdorf (Kanton Uri), Yverdon (Waadt) und Aarau (Aargau) durchgeführt. |
1951 | Der Versuchs-Gyrobus (Kontrollschild ZH 50368) verkehrt im sankt-galler Rheintal ab 30. März zwischen Heerbrugg, Diepoldsau und Hohenems (Österreich). |
1953 | Am 30. September wird der Gyrobus-Betrieb zwischen Yverdon und Grandson mit zwei Bussen MFO/FBW/CA eröffnet. |
1955 | Eine Flotte von 12 vollständig in der Schweiz durch MFO/FBW/CA gebauten Gyrobussen nimmt in Léopoldville, Belgisch-Kongo (heute Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo) am 6. August den Betrieb auf. Insgesamt werden vier Linien befahren. |
1955 | Die ersten drei MFO-Gyrolokomotiven werden in Goldminen in der Nähe von Johannesburg in Südafrika geliefert. |
1956 | Die letzten drei von MFO/FBW/CA gebauten Gyrobusse werden an die Stadt Gent in Belgien geliefert. Der Betrieb wird am 10. September aufgenommen. |
1956 | Der «National Coal Board» in England stellt zwei Rangierlokomotiven mit je zwei MFO-Gyros in Betrieb. |
1959 | Einstellung des Gyrobus-Betriebs in Belgien am 24. November. |
1960 | Einstellung des Gyrobus-Betriebs in Yverdon am 31. Oktober. |
1985 | Zum 100-Jahr-Jubiläum der städtischen Verkehrsbetriebe von Oostende in Belgien verkehrt der restaurierte Gyrobus G3 zwischen 16. Juli und 18. August. |
2003 | Der Gyrobus G3 aus Belgien nimmt am 50-Jahr-Jubliäum der städtischen Verkehrsbetriebe von Yverdon-les-Bains vom 4. Oktober statt. |
| Das einzige in Betrieb stehende Gyro-Fahrzeug ist eine Tunnel-Lokomotive, welche im stillgelegten Eisenerz-Bergwerk Gonzen bei Sargans in der Schweiz (www.bergwerk-gonzen.ch, Telefon 081 723 12 17) den «Gonzenexpress» auf einer Strecke von rund zwei Kilometern durch den Berg zieht. |
Chassis-Nummern und Wagenfarben
| 812 | 1 Versuchs-Gyrobus. aufgebaut auf einem Lkw-Chassis aus dem Jahre 1932. Wagenfarbe: VBZ-Blau mit weissem Fensterband. |
| 3495 / 3496 | 2 Gyrobusse nach Yverdon-les-Bains. Wagenfarbe: Leuchtrot mit gelbem Fensterband. |
| 3497 | 1 Chassis geliefert an MFO, wurde Vorführfahrzeug MFO. |
| 3644 – 3655 | 12 Gyrobusse nach Léopoldville, Belgisch-Kongo. Wagenfarbe: VBZ-Blau mit weissem Fensterband. |
| 3898 – 3900 | 3 Gyrobusse nach Gent, Belgien. Wagenfarbe: Leuchtrot mit gelbem Fensterband. |

Webmaster
Diese Story über FBW Gyrobusse und die gesamte Website wurde von Sven H. Tiemann umgesetzt und gestaltet. Sven Tiemann ist Informatik-Projektleiter im Bereich Öffentliche Verwaltungen.

Der Autor
Der Autor Beat Winterflood ist Diplomingenieur und arbeitet als Industriehistoriker und Verkehrsexperte für Industrie, Politik und die europäische Qualitätsfachpresse

Willi Müller; Chronikstube Wetzikon
Konrad Hirzel, Urs Howald, Heinz Stamm; Feuerwehr Wetzikon
Reto Bereuter, Hans und Vreni Billeter, Jakob Meier, Willy Störchlin, Peter Meyer; FBW Club
Max Schulthess; Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich VBZ
Michèle Matt; Rheintal Bus RTB
Fritz von Ow, Hinwil
Josef Wespe, Altstätten